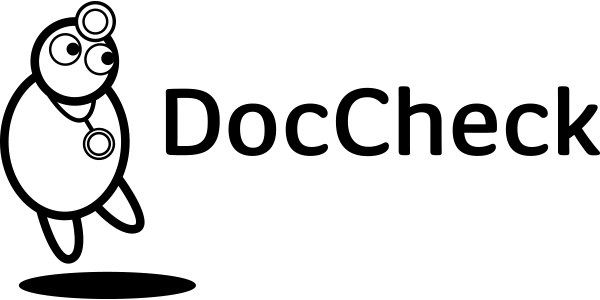PCOS mit GLP-1-Rezeptoragonisten behandeln?
Original Titel:
Efficacy and safety of GLP-1 receptor agonists on weight management and metabolic parameters in PCOS women: a meta-analysis of randomized controlled trials
- GLP-1-Rezeptoragonisten: Auch bei PCOS einsetzbar?
- Systematischer Review mit Metaanalyse über 13 randomisiert-kontrollierte Studien
- GLP-1RA verbessern effektiv Körpergewicht, BMI und Insulinresistenz bei PCOS, aber mit Nebenwirkungen
MedWiss – Bei Frauen mit PCOS konnte die Behandlung mit GLP-1-Rezeptoragonisten nach einem systematischen Review mit Metaanalyse über 13 Studien effektiv Körpergewicht, BMI und Insulinresistenz verbessern. Allerdings kam es bei den Patientinnen häufiger zu Übelkeit, Erbrechen und Schwindel. Weitere Studien müssen die langfristigen Effekte der Behandlung ermitteln.
Klinisch zeigt sich das polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS) sehr heterogen. Vorrangig wird es durch seltene oder nicht stattfindende Ovulation, erhöhte Androgen-Spiegel und polyzystische Veränderungen der Ovarien gekennzeichnet. Häufig liegen aber auch eine Insulinresistenz, Adipositas, Dyslipidämie und weitere Stoffwechselstörungen vor. GLP-1-Rezeptoragonisten (Glucagon-like peptide-1), beispielsweise Exenatid, und GLP-1-Analoga wie Liraglutid, werden vor allem zur Behandlung bei Typ-2-Diabetes eingesetzt, wurden aber auch bei PCOS untersucht. Bei PCOS wurden reduzierte Spiegel von GLP-1 beschrieben. Individuelle Studien zeigten vielversprechende Ergebnisse mit GLP-1RA bei PCOS, aber Wirksamkeit und Sicherheit müssen noch umfassend evaluiert werden.
GLP-1-Rezeptoragonisten: auch bei PCOS?
Der vorliegende systematische Review mit Metaanalyse untersuchte Wirksamkeit und Sicherheit von GLP1-RA bei PCOS im Vergleich zu Behandlungen mit Metformin oder einem Placebo. Behandlungsziele waren Verbesserungen von Körpergewicht, Glukosestoffwechsel und Hormonspiegel. Die systematische Recherche ermittelte randomisiert-kontrollierte Studien aus den medizin-wissenschaftlichen Datenbanken PubMed, EMBASE, Cochrane Library, Web of Science und Google Scholar, mit Veröffentlichung bis Oktober 2024.
Die Studie erfasste Veränderungen im BMI (body mass index), Körpergewicht, Taillenumfang, Taillen-zu-Hüfte-Verhältnis und Bauchumfang. Zum Glukosestoffwechsel ermittelten die Wissenschaftler Nüchternglukose, Nüchterninsulin, OGTT und Insulinresistenz (HOMA-IR). Als Hormonspiegel untersuchte die Studie DHEAS, SHBG, Gesamt- und freies Testosteron und FAI. Zusätzlich wurde das Lipidprofil anhand von Gesamtcholesterin, HD-Lipoprotein, LD-Lipoprotein und Triglyzeriden untersucht.
Systematischer Review mit Metaanalyse über 13 randomisiert-kontrollierte Studien
Die Metaanalyse umfasste 13 randomisiert-kontrollierte Studien mit zusammen 397 Frauen mit PCOS, die GLP-1RA erhielten, sowie 330 Frauen, die Metformin erhielten. Weitere 68 Teilnehmerinnen erhielten ein Placebo. Die Behandlung mit GLP-1RA war mit einer Reduktion des BMI sowohl im Vergleich zu Metformin (Mittelwertdifferenz, MD: -1,11; 95 % Konfidenzintervall, KI: -1-84 − -0,38; p = 0,003) als auch zum Placebo (MD: -1,59; 95 % KI: -2,07 − -1,10; p < 0,0001). GLP-1RA-Interventionen waren auch mit reduziertem Körpergewicht im Vergleich zu Metformin (MD: -1,81; p < 0,0001) oder Placebo (MD: -5,44; p < 0,0001) assoziiert. GLP-1RA reduzierten außerdem Taillenumfang, Taille-zu-Hüfte-Verhältnis und Bauchumfang signifikant (alle p < 0,0001).
Der Glukosehaushalt wurde mit Blick auf Nüchterninsulin, Glukosespiegel 2 Stunden nach oralem Glukosetoleranztest und Insulinresistenz signifikant mit GLP-1RA verbessert. Zudem wurde eine Reduktion von HD-Lipoprotein festgestellt. Andere Parameter waren unverändert. Die Behandlung mit GLP-1RA ging mit signifikant häufigerer Übelkeit (p = 0,02), Erbrechen (0,04) und Schwindel (0,03) einher.
GLP-1RA verbessern effektiv Körpergewicht, BMI und Insulinresistenz bei PCOS, aber mit Nebenwirkungen
Bei Frauen mit PCOS konnte die Behandlung mit GLP-1-Rezeptoragonisten demnach effektiv Körpergewicht, BMI und Insulinresistenz verbessern. Allerdings kam es bei den Patientinnen häufiger zu Übelkeit, Erbrechen und Schwindel. Weitere Studien müssen die langfristigen Effekte der Behandlung ermitteln.
© Alle Rechte: MedWiss.online