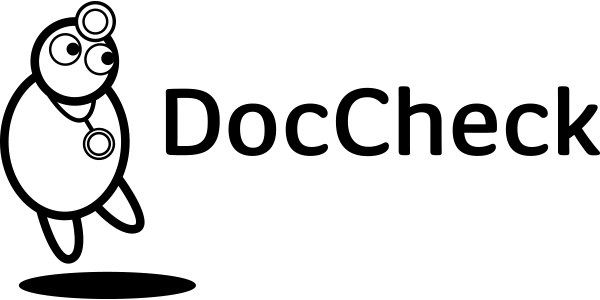Multimodales Physiotherapiekonzept überzeugt bei Migräne
Original Titel:
Effects of combining manual therapies, neck muscle exercises, and therapeutic education pain neuroscience in patients with migraine: a 3-armed randomized clinical trial
- Multimodale physiotherapeutische Konzepte bei Migräne unzureichend erforscht
- Parallele randomisiert-kontrollierte Studie über 12 Wochen, Follow-up nach 1, 2 und 4 Monaten
- 3 Studiengruppen: Schmerzaufklärung, manuelle Therapie, Kombination plus Nackenübungen
- Alle Gruppen mit signifikanter Verbesserung der Kopfschmerzen (HIT-6-Werte) nach 12 Wochen
- Manuelle Therapie zeigte nach 4 Wochen die stärksten Effekte
- Schmerzaufklärung erzielte nach 12 Wochen bessere Werte als manuelle Therapie
- Multimodale Therapie war Einzeltherapien im Follow-up überlegen
MedWiss – Angesichts der hohen Belastung durch Migräne und der begrenzten Wirksamkeit medikamentöser Therapien rücken physiotherapeutische Konzepte zunehmend in den Fokus der Forschung. Ein multimodaler Therapieansatz, bestehend aus Schmerzaufklärung, manueller Therapie und Übungen für die Halswirbelsäule, war bei Menschen mit Migräne langfristig wirksamer als einzelne Behandlungsformen. Besonders deutlich waren die Verbesserungen bei Kopfschmerzbelastung, Nackenschmerzen, Lebensqualität und psychosozialen Faktoren.
Physiotherapie stellt einen nicht-medikamentösen Ansatz zur Behandlung von Migräne dar. Die Wirksamkeit eines multimodalen Ansatzes, d. h. der Kombination aus Schmerzaufklärung, manuellen Therapien und Halswirbelsäulenübungen im Vergleich zu einzelnen Maßnahmen ist bislang unklar. Das Ziel einer internationalen Studie war es, die Effekte eines solchen multimodalen Konzepts gegenüber manueller Therapie oder alleiniger Schmerzaufklärung bei Menschen mit Migräne zu untersuchen.
Physiotherapie, manuelle Therapie, Schmerzedukation – was hilft bei Migräne?
Die Studie wurde als 3-armige, parallele, einfach-verblindete, randomisierte klinische Studie über 12 Wochen durchgeführt. Symptome wurden zu Beginn sowie nach 4, 8 und 12 Wochen und erneut im Follow-up nach 1, 2 und 4 Monaten erfasst. Die Teilnehmer wurden randomisiert einer therapeutischen Schmerzaufklärung (TEG), manueller Therapie (MTG) oder einer multimodalen Behandlung zugewiesen. Der primäre Endpunkt war die Kopfschmerzbelastung, gemessen mit dem Headache Impact Test (HIT-6). Sekundäre Endpunkte umfassten u. a. Häufigkeit, Intensität und Dauer der Kopfschmerzen, Beeinträchtigung des Nackens (Neck Disability Index, NDI), Allodynie (Allodynia Symptom Checklist, ASC-12), maladaptive Überzeugungen, Schmerzkatastrophisieren, Lebensqualität, Schwindel sowie zervikale Tests.
3-armige randomisierte Studie über 12 Wochen mit Follow-up mit 75 Teilnehmern
Insgesamt wurden 75 Menschen mit Migräne zufällig einer der 3 Gruppen zugeordnet. In allen Gruppen verbesserte sich die HIT-6-Skala signifikant (p < 0,001). Die manuelle Therapie zeigte die stärksten Effekte nach 4 Wochen, während die Gruppe mit Schmerzaufklärung nach 12 Wochen bessere Werte als die manuelle Therapie erzielte. Im Follow-up zeigte die multimodale Gruppe die deutlichste Reduktion in der Kopfschmerzbelastung. Die Ergebnisse einer Gruppen-zu-Zeit-Analyse sprachen für den multimodalen Ansatz hinsichtlich Kopfschmerzfrequenz, -intensität, Nackenschmerzen, Allodynie, Nackenbeeinträchtigung, Lebensqualität und dem Flexions-Rotations-Test (p < 0,01). Die multimodale Gruppe wies zudem klinisch relevante Verbesserungen in der Nackenbeeinträchtigung, der Schmerzkatastrophisierung, der Lebensqualität, der Allodynie und der Bewegungsangst auf.
Alle Behandlungsformen zeigen Wirkung, multimodale Therapie überlegen
Alle untersuchten Therapieformen waren bei Menschen mit Migräne wirksam, wobei der multimodale Therapieansatz am besten abschnitt. Die multimodale Untersuchungsgruppe zeigte bei der Nachuntersuchung klinisch relevante Veränderungen der Kopfschmerzbelastung sowie eine Reduktion von Kopf- und Nackenschmerzen. Auch psychosoziale Parameter verbesserten sich. Diese Veränderungen deuten auf positive Effekte im Hinblick auf die körperliche Funktionsfähigkeit und die Schmerzverarbeitung hin.
© Alle Rechte: MedWiss.online