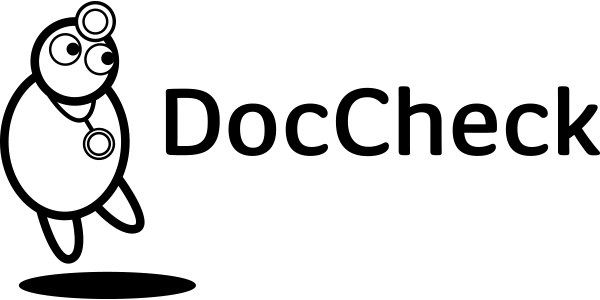Longevity
Anhaltende Schlafprobleme ein Demenzrisiko?
Original Titel:
Associations of Chronic Insomnia, Longitudinal Cognitive Outcomes, Amyloid-PET, and White Matter Changes in Cognitively Normal Older Adults
- Anhaltende Schlafprobleme ein Demenzrisiko?
- Analyse von 2 750 Personen in USA-bevölkerungsweiter Alterungsstudie
- Anhaltende Schlafstörungen ein Problem, länger schlafen nicht
MedWiss – Eine Analyse über 2 750 ältere Personen in einer Alterungsstudie in den USA spricht für einen Zusammenhang zwischen anhaltenden Schlafstörungen (Insomnie), kognitivem Abbau und erhöhtem Risiko für kognitive Beeinträchtigungen. Besonders reduzierter Schlaf ist demnach problematisch, die Nutzung von Schlafmitteln hingegen nicht.
Als Insomnie bezeichnet man anhaltende Schwierigkeiten, einzuschlafen oder durchzuschlafen. Häufig geht dies mit Erwachen am frühen Morgen und schlechter Schlafqualität einher. Diese Symptome beeinträchtigen typischerweise die Tagesfunktionalität, gehen mit Fatigue und Stimmungschwankungen einher und schlagen sich in der Denkleistung nieder.
Obwohl es zunehmend Hinweise darauf gibt, dass Insomnie mit Demenzerkrankungen in Zusammenhang steht, sind die zugrundeliegenden Mechanismen unklar. Wissenschaftler vermuten, dass Schlafstörungen mit zerebrovaskulären Veränderungen einhergehen, die zu Demenzerkrankungen führen könnten. Daher untersuchten sie nun anhand einer bevölkerungsweiten Alterungsstudie in den USA Zusammenhänge zwischen chronischer Insomnie, langfristigen kognitiven Verläufen und der Gehirngesundheit älterer Erwachsener.
Anhaltende Schlafprobleme ein Demenzrisiko?
Die Autoren erfassten kognitiv unbeeinträchtigte ältere Erwachsene aus einer bevölkerungsweiten Alterungsstudie (Mayo Clinic Study of Aging), mit oder ohne Diagnose einer chronischen Insomnie. Die Teilnehmer wurden jährlich neuropsychologisch und mittels bildgebender Verfahren untersucht, um Hinweise auf eine Alzheimer-Erkrankung (Amyloid-PET-Last) und vaskuläre pathologische Veränderungen (Hyperintensitäten der weißen Substanz im MRT, Magnetresonanztomographie; % des intrakraniellen Volumens) zu ermitteln. Die Analyse verglich Insomnie und langfristige kognitive Leistungen, Hyperintensitäten der weißen Substanz und die Amyloid-PET-Spiegel unter Berücksichtigung verschiedener eventuell relevanter Faktoren wie beispielsweise einer vorbestehenden Schlafapnoe.
Analyse von 2 750 Personen in USA-bevölkerungsweiter Alterungsstudie
Die Analyse umfasste 2 750 Personen im durchschnittlichen Alter von 70,3 Jahren (± 9,7 Jahre), von denen 49,2 % Frauen waren. Im Mittel wurden die Teilnehmer über 5,6 Jahre nachbeobachtet. Die Analyse der weißen Substanz-Hyperintensitäten schloss Daten von 1 027 Personen ein, von 561 Personen konnte die Amyloid-PET-Last betrachtet werden. Insomnie war mit einem signifikant schnelleren Abbau der gesamten kognitiven Leistung assoziiert (p = 0,028) sowie mit einem um 40 % erhöhten Risiko für kognitive Einschränkungen (Hazard Ratio, HR: 1,4; 95 % Konfidenzintervall, KI: 1,07 – 1,85; p = 0,015).
Insomnie mit reduziertem Schlaf war mit schlechterer kognitiver Leistung zu Beginn der Studie assoziiert (β = -0,211; 95 % KI: -0,376 – -0,046; p = 0,012), mehr Hyperintensitäten der weißen Substanz (β = 0,147; 95 % KI: 0,044 – 0,249; p = 0,005) und höherer Amyloid-PET-Last (β = 10,5; 95 % KI: 0,5 – 20,6; p = 0,039). Personen mit Insomnie, die mehr als üblich schliefen, hatten hingegen weniger Hyperintensitäten der weißen Substanz zu Beginn der Studie (β = -0,142; 95 % KI: -0,268 – -0,016; p = 0,028).
Generell war Insomnie aber nicht mit der Zuwachsrate an Hyperintensitäten der weißen Substanz oder der Amyloid-Akkumulation assoziiert. Bei Teilnehmern mit Insomnie stand zudem die Nutzung von schläfrig machenden Wirkstoffen (Hypnotika) nicht mit der Denkleistung in Zusammenhang (β = 0,016; 95 % KI: -0,201 – 0,233; p = 0,888) ebenso wie mit dem Risiko für eine neuauftretende kognitive Beeinträchtigung (HR: 0,94; 95 % KI: 0,5 – 1,6; p = 0,832).
Anhaltende Schlafstörungen ein Problem, länger schlafen nicht
Die Autoren schließen, dass ihre Analyse den vermuteten Zusammenhang zwischen anhaltenden Schlafstörungen (Insomnie), kognitivem Abbau und erhöhtem Risiko für kognitive Beeinträchtigungen unterstützt. Speziell Insomnie mit reduziertem Schlaf war demnach mit geringerer Gehirngesundheit assoziiert. Bei Schlafstörungen, so das Fazit, könnten Behandlungen zur Verbesserung des Schlafs und der Schlafdauer womöglich zu einer besseren Gesundheit des Gehirns und Reduktion des Demenzrisikos beitragen.
Weitere Informationen zu Prävention und HealthyAging auch bei staYoung
© Alle Rechte: MedWiss.online